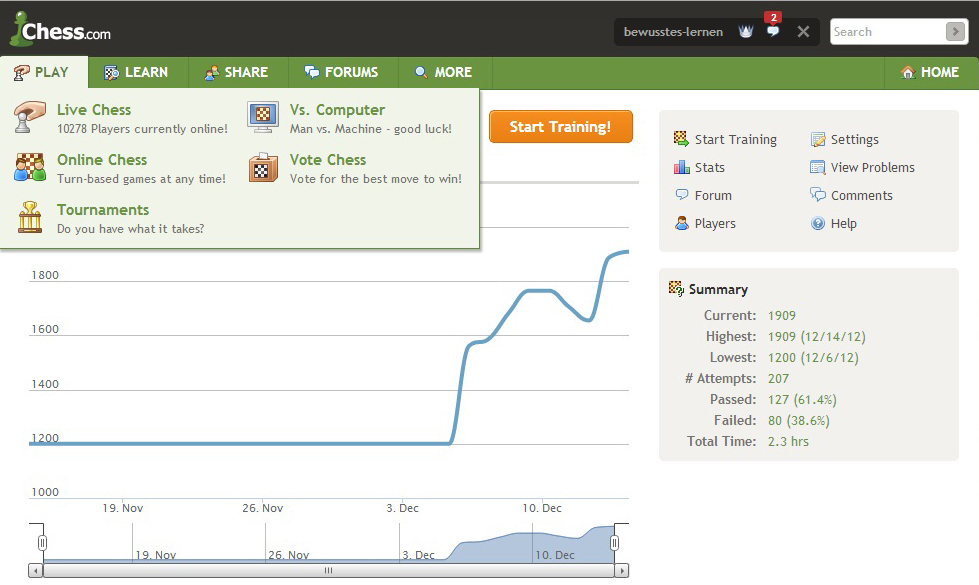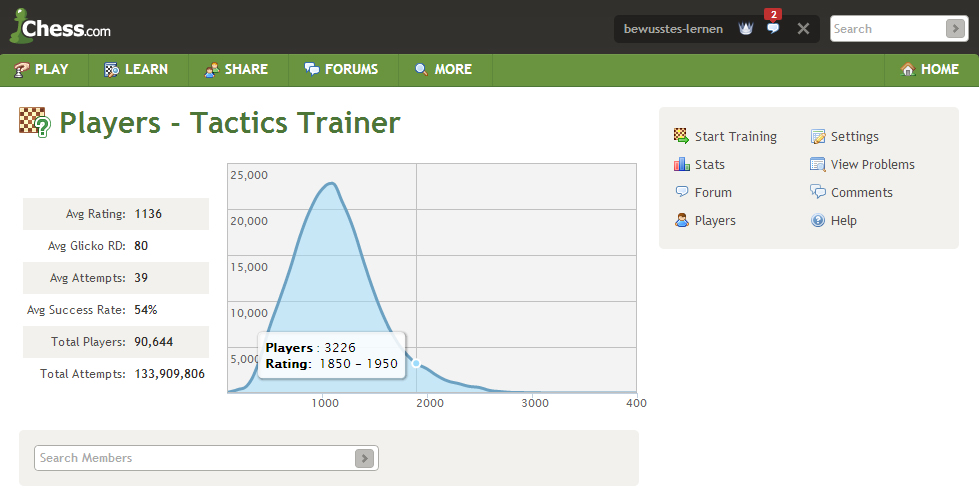Wir haben den Kontakt zu den Genies verloren. In der postmodernen Souver√§nit√§t des Individuums weigern sich die Durchschnittsprofilneurotiker in die Fu√üstapfen anderer zu treten, da sie andernfalls keine eigenen Fu√üstapfen mehr hinterlassen w√ľrden. Doch der Schnee ist l√§ngst niedergetrampelt von den Genies vormaliger Generationen, so dass den angeblich gro√üen Denkern unserer Zeit nur √ľbrig bleibt in der grauem Masse zu verschwinden. Genies wurden nach und nach demontiert. Der Nerd selbst ist zum Massenph√§nomen geworden. So gibt es auch keine gro√üen Philosophen mehr. Konnte Quine mit seinem „Two Dogmas of Empiricism“ noch an die 500.000 Folgeartikel verzeichnen, ist der Markt heute v√∂llig pluralisiert.¬†(Titelbildnachweis:¬†Towpilot [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
Die Faszination an der √úberleistung hat sich √ľberlebt, allerdings wird diese nun demokratisch identifiziert. Wenn wir Menschen wie Madonna zur gr√∂√üten S√§ngerin des Planeten hochjubeln, die Beatles zu Vollblutkomponisten emporheben, die aus dem selben Holz wie Mozart geschnitzt w√§ren, oder tats√§chlich glauben Justin Bieber w√ľrde dazu im Vergleich minderwertige Musik machen, dann hat sich der Glaube an die gr√∂√üeren Gedanken schlichtweg kaputtdemokratisiert. Der Aufstieg zu den Gipfeln der Menschheit beginnt heute in den Basislagern des Durchschnitts. Genie ist Dominanz in der Popkultur. Es gibt daher keine Geniefilme, die nicht immer auch die Sehnsucht der Massen nach schneller Geltung reflektieren. Das Genie der konstanten T√§tigkeit ist verschwunden.
Zur Demontage des Geniemythos geh√∂rt allerdings schon viel fr√ľher die nach dem ersten Weltkrieg einsetzende Angst vor den Abgr√ľnden unserer Vernunft. Wir glaubten nicht mehr, dass der reine Intellekt die Welt ver√§ndern w√ľrde, da er zumeist auch dem B√∂sen diente und Menschen durch ungeheure Kriegsmaschinerien verwurstete. Doch die endg√ľltige Heroisierung unserer Vernunft und Genieangst in Philosophie, Kunst und Literatur sollte erst mit „Das Schweigen der L√§mmer“ ihren Durchbruch auf der Leinwand finden. Hannibal Lector war hier wohl der H√∂hepunkt einer Thrillerbranche, die den Serienm√∂rder als Spiegel unserer √Ąngste entdeckte. Der kultivierte M√∂rder, der komponiert, Shakespeare auswendig kann, St√§dte aus dem Ged√§chtnis malt, Pers√∂nlichkeiten am Parfum erkennt, Charme und ein unleugbares Charisma besitzt, der schlie√ülich allen unseren seelischen Abgr√ľnden sofort auf die Schliche kommt, der selbst in seiner Kochkunst universell begeistert, w√ľrde er nicht generell Menschenfleisch bevorzugen, dieses Genie der Tugenden hat doch letztlich einen b√∂sen Willen. Was Kant schon wusste, dass jede Tugend auch dem B√∂sen zutr√§gt, so war in Hannibal Lecter die Genialit√§t mit dem Antichristen identifiziert.
Die Amerikaner haben hier √ľbrigens noch ein viele deutlichere Abneigung gegen√ľber den Liberal Arts als wir. Der Durchschnittsamerikaner glaubt, Bildung schade dem Staat und sei irgendwie b√∂se, weswegen mehr und mehr konservative Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten.
Hannibal hinter Masken und St√§ben versperrt ist wie ein berechnendes Tier, dass ungez√§hmt Gesichter von Menschen abzieht und auf seine Chance auf Freiheit lauert. Die Konfrontation mit der inneren Psyche unseres K√∂nnens, die Konfrontation mit den Grenzen des Genies ist hier Thema des Films. Der eigentliche M√∂rder ger√§t zum Beiwerk und die Faszination f√ľr das Genies ist hier der Umschlagplatz f√ľr unsere √Ąngste. Wenn Wissen Macht ist, dann muss das Genie gerade uns bedrohen, die wir ja in Wirklichkeit keine Genies sind und alles hart erarbeiten. Hannibal bedroht uns uns nicht mit der M√∂glichkeit uns zu verspeisenn. Der Kampf findet wohl bewusst in der Psyche statt. Wo Menschen nicht mehr in die Fu√üstapfen anderer treten k√∂nnen, dort bedroht das andere Genie das schwache Leuchten des eigenen Lichts und so ist „Das Schweigen der L√§mmer“ eine psychische Konfrontation der Protagonisten.
Nach finanziellen Erfolgen kann sich Hollywood einer Fortsetzungen regelm√§√üig nicht erwehren. Daher hatte „Das Schweigen der L√§mmer“ auch einen Nachfolger. Aus der urspr√ľnglichen Reise in die Motive der „Guten“ aber – Starling und Lecter verfolgten ja einen h√§utenden Serienm√∂rder, wird hier allein das b√∂se Genie vorgestellt. Dieses B√∂se muss dem Guten immer √ľberlegen sein, da es eine versteckte Realit√§t besitzt. Dort wo das Gute nicht hinblicken soll, hinter der Intelligenz unseres Selbst verbirgt sich an den blinden Flecken der Abgrund. Dort wo unsere Intelligenz endet, dort beginnt das B√∂se, das sich unserer Verstandeskraft entzieht. Der Verbrecher, da er sich vor den Guten verstecken muss, muss immer schlauer sein. Jeder Versuch daher die Kriminalit√§t aus dem Schatten zu holen, hebt neue Schatten hervor. So ist die Fortsetzung „Hannibal“ nicht mehr die Frage nach unserem Gutmenschentum und unseren psychischen Abgr√ľnden, sondern bl√ľht auf im postmodernen Gemetzel ohne Moral, das schon Tarantino nach „Das Schweigen der L√§mmer“ etablierte. Das Genie ist nur noch ein Genie ohne Moral und keine erstrebenswerte Veredlung enth√§lt sich mehr in der Intelligenz.
Hannibal soll daher der Höhepunkt menschlicher Schaffenskraft sein, was nicht bedeutet, dass dieser Höhepunkt Gutes bedeutet. In Florenz mordet Hannibal schlichtweg kultiviert zu Opernklängen.
Das Umfeld ist dabei schon wie im Film zuvor nicht mehr als ein Humphrey-Bogart-Film. Hollywood bedient Klischees um die Handlung marktgerecht voranzutreiben. Ein blasser Agent Starling ist umgeben von sexistischen St√ľmpern, kettenrauchenden, italienischen Detektiven und einem Milliad√§r, der mit Schwachk√∂pfigen Handlangern Gel√ľste auslebt, wie er es f√ľr richtig h√§lt. Selbst Starling wirkt wie ein Teenager mit Zahnspange, die auf den manipulativen, greisen Intelligenzbolzen herein f√§llt. Wer hier aber Klischees kritisiert, muss sich bewusst sein, dass die Welt aus eben diesen Klischees tats√§chlich besteht: Menschen, die nicht mehr in die Fu√üstapfen anderer treten wollen und doch genau wie die Abziehbilder von der Leinwand sind.
Lecter ist der Geniekult in jedem von uns. Der Geltungsdrang und √úberheblichkeit. Gleichsam sind wir eingeschlossen, in das Umfeld der Durchschnittlichkeit. Wir sind auch nicht mehr als die Masse der Demokratie.
Mit Sicherheit hatte der erste Film dem zweiten Film psychologische Tiefe voraus und ich weiß noch, wie ich als junges Kind schlichtweg Angst vor allen, diesen Szenen hatte:
Weitere Filme, die es in die engere Auswahl von Geniefilmen geschafft haben, sind 21 РPoker, Pirates of Silicon Valley, The Social network, Inside Man, Phenomenon, Be Cool (Schnappt Shorty), Rounders, Schlafes Bruder, Das Wunderkind Tate, Oscar Wilde, Real Genius, Iron Man, Einstein Junior, Liebe ist relativ, Der talentierte Mr. Ripley, Das Parfum, Inception, Aviator, Der Mann, der die Frauen liebte, A beautyful mind, Forrester, Ridicule РVon der Lächerlichkeit des Scheins.
In meiner Top Ten sind: Prestige РMeister der Magie, Catch me if you can, Die Schachnovelle, Das wilde Schaf, Gandhi, Rain Man, Shine,  Good will hunting, Ohne Limit (Dieser Film läuft bei dem Thema außer jeder Konkurrenz), die Legende vom Ozeanpianisten
Ich werde diese Filme noch besprechen und ich w√ľrde mich freuen, wenn ihr weitere Vorschl√§ge macht oder meinen Blog verfolgt.¬†Ansonsten k√∂nnt ihr auch gerne auch meiner¬†Pinterestgruppe¬†zu motivierenden Pers√∂nlichkeiten beitreten.¬†Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann¬†added mich doch bitte bei¬†Google+, abonniert mich per¬†E-mail¬†oder tretet der¬†Facebookgruppe¬†oben rechts bei. Ein RSS-Feed ist nat√ľrlich auch vorhanden sowie eine¬†Pinterestwall zum Thema Lernen. Ansonsten k√∂nnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr mal gemeinsame Projekte im Sinn habt. Ach und teilen, w√§re auch nett, damit ich das hier nicht immer nur f√ľr mich schreibe :)